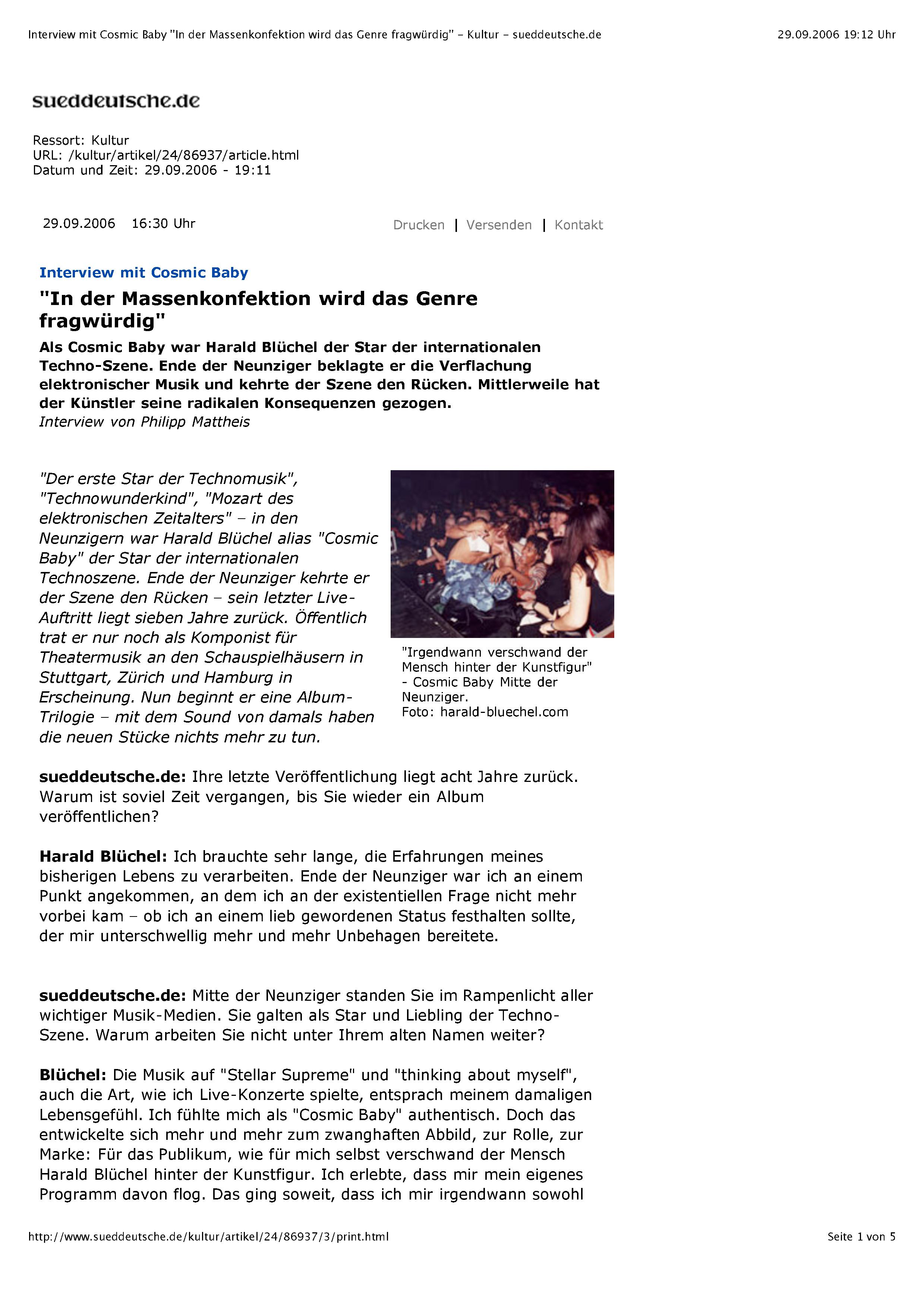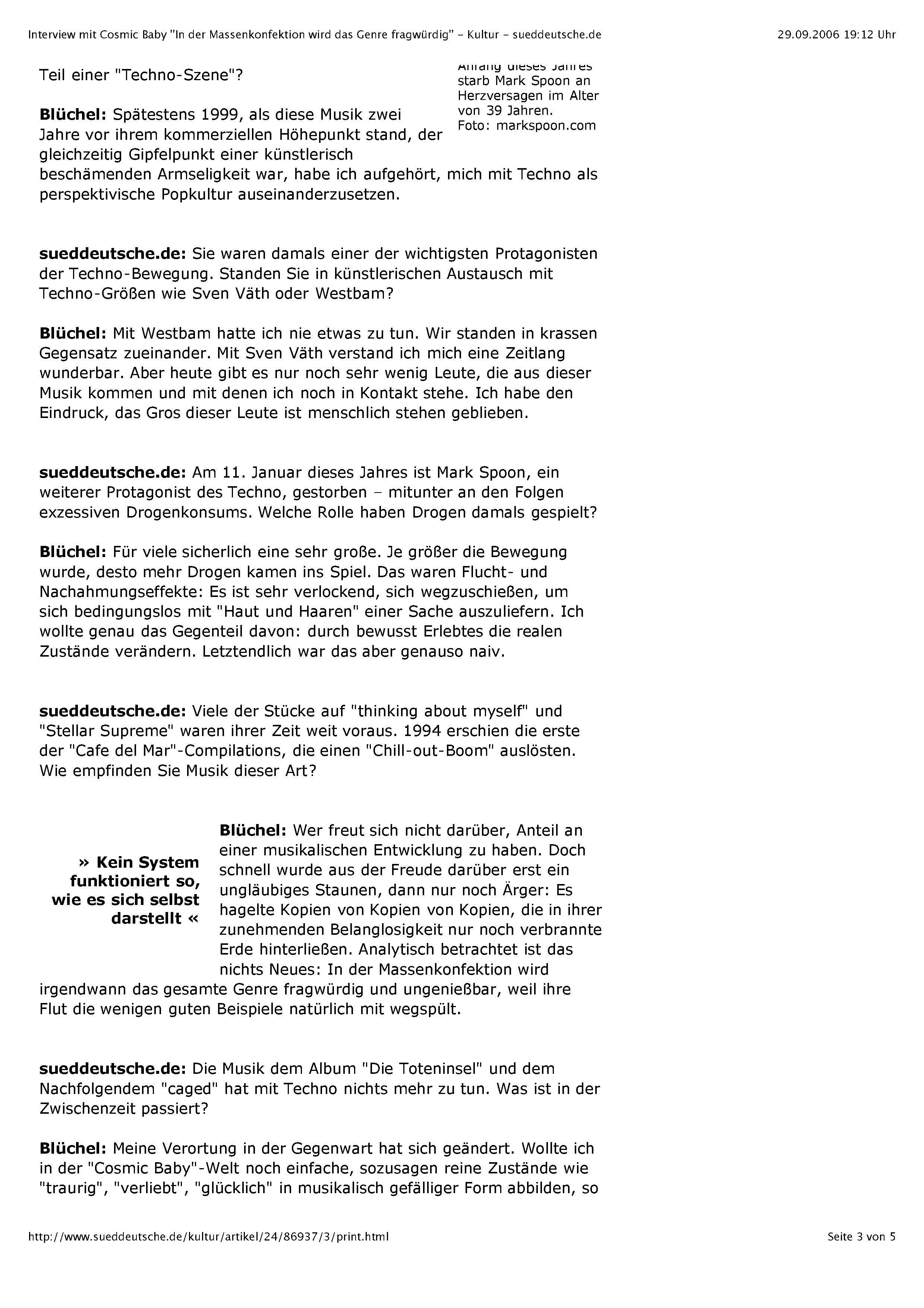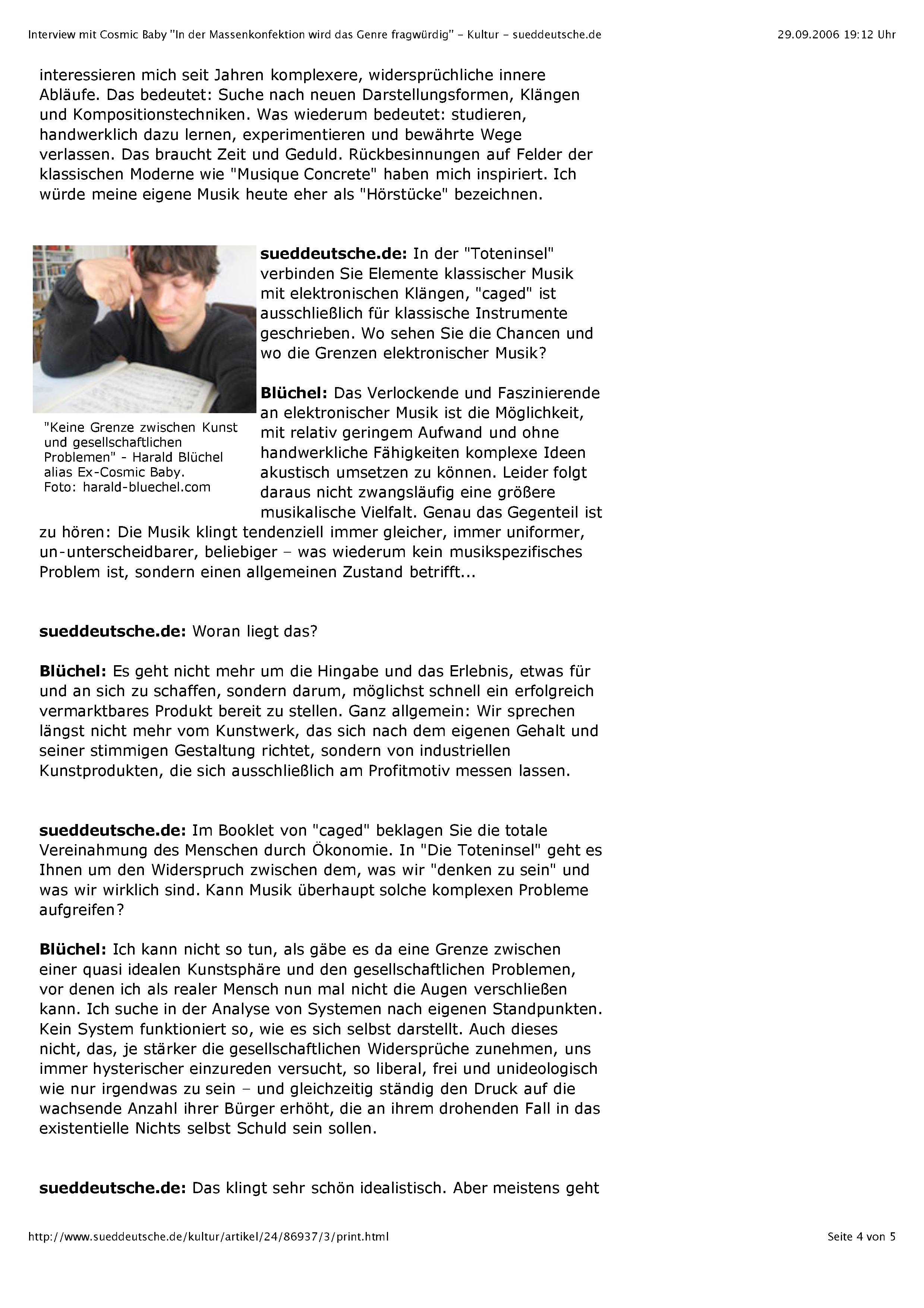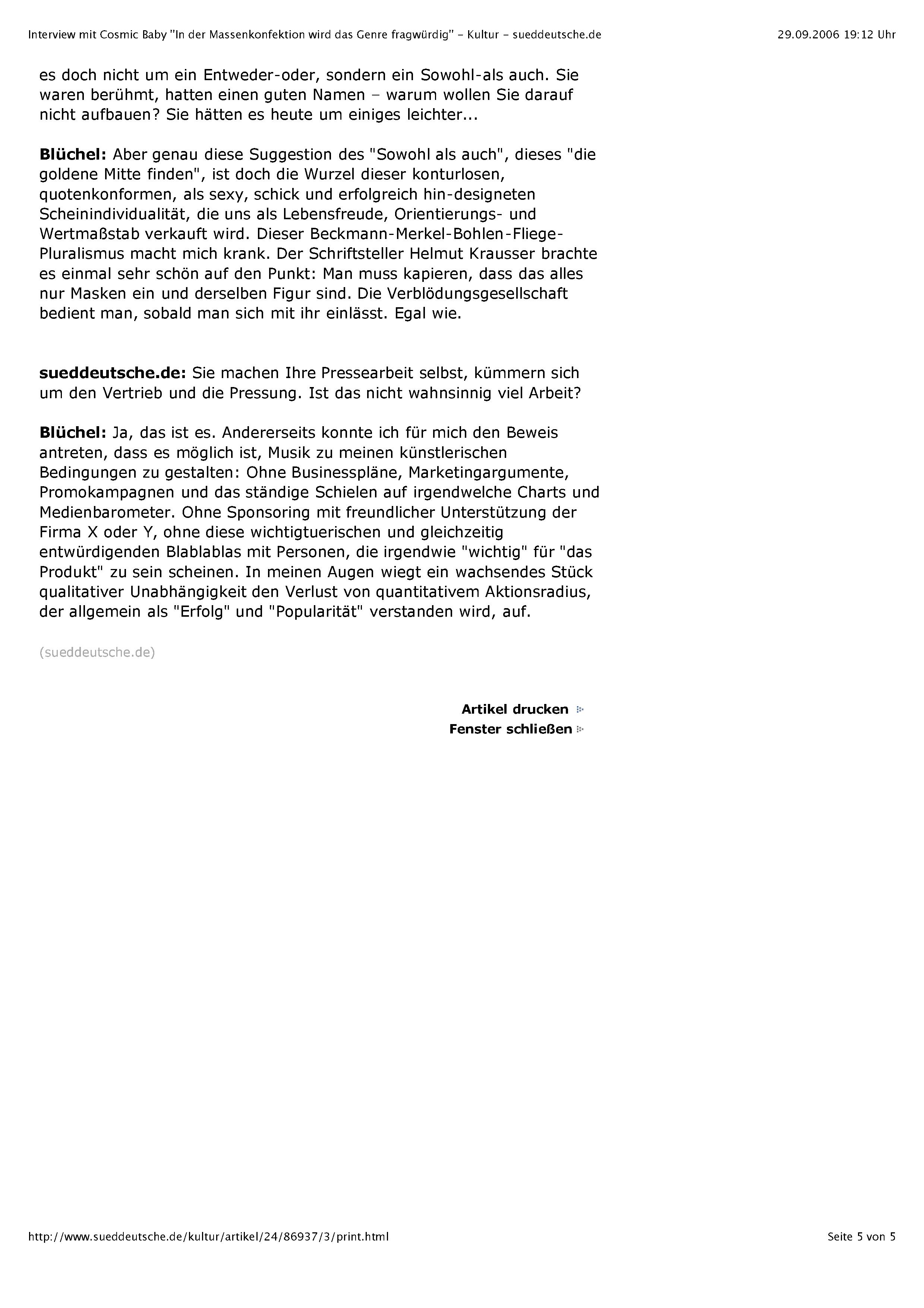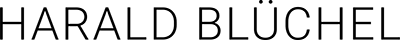“In der Massenkonfektion wird das Genre fragwürdig”
„Der erste Star der Technomusik“, „Technowunderkind“, „Mozart des elektronischen Zeitalters“ – Anfang bis Mitte der Neunziger war Harald Blüchel der Star der internationalen Technoszene. Unter dem Pseudonym „Cosmic Baby“ wurde er zum Publikumsliebling und war auf den Titelblättern nahezu jeder wichtigen Musikzeitschrift zu sehen. Ende der Neunziger kehrte er der Szene den Rücken – 1998 erschien sein letztes Soloprojekt, der letzte Live-Auftritt liegt sieben Jahre zurück. Öffentlich trat er nur noch als Komponist für Theatermusiken an den Schauspielhäusern in Stuttgart, Zürich und Hamburg in Erscheinung. Nun beginnt er eine Album-Trilogie zu veröffentlichen– mit dem Sound von damals haben die neuen Stücke nichts mehr zu tun.
Ihre letzte Veröffentlichung liegt acht Jahre zurück. Warum ist soviel Zeit vergangen, bis Sie wieder ein Album veröffentlichten?
Ich brauchte eine sehr lange Zeit, die Erfahrungen meines bisherigen Lebens zu verarbeiten. Ende der Neunziger war ich an einem Punkt angekommen, an dem ich an der existentiellen Frage nicht mehr vorbei kam, ob ich an einem lieb gewordenen Status festhalten sollte, der mir unterschwellig mehr und mehr Unbehagen bereitete.
„Der erste Star der Technomusik“, „Technowunderkind“, Protagonist in „Lost in Music“, eine Beitrag des „ARD Kulturweltspiegel“. Sie standen Mitte der Neunziger im Rampenlicht aller wichtiger Musik-Medien. „Cosmic Baby“ war Star und Liebling der Techno-Szene. Warum arbeiten Sie nicht unter Ihrem alten Namen weiter?
Die Musik auf „Stellar Supreme“ und „Thinking about myself“, auch die Art, wie ich Live-Konzerte spielte, entsprach meinem damaligen Lebensgefühl. Ich fühlte mich als Identität „Cosmic Baby“ authentisch. Doch das entwickelte sich mehr und mehr zum zwanghaften Abbild, zur Rolle, zur Marke: Für das Publikum, wie für mich selbst verschwand der Mensch Harald Büchel hinter der Kunstfigur. Ich erlebte, dass mir mein eigenes Programm davon flog. Das ging soweit, dass ich mir irgendwann sowohl im Studio als auch im öffentlichen Raum die Gedanken machte: entspricht das jetzt noch „Cosmic Baby“ oder nicht? Erst in der Reflektion, aus einem gewissen Abstand heraus wurde mir klar, daß es sich hierbei nicht nur um ein individuelles, sondern um ein allgemein gesellschaftliches Dilemma handelt…
Weil man versucht, einem Bild zu entsprechen, das die Umwelt von einem hat?
Genau. Jeder versucht sich den Erwartungen seiner Umwelt entsprechend zu verhalten, weil man in einer auf Konkurrenz und Markt basierenden Gesellschaftsform eben nur derjenige zählt, der „erfolgreich“ ist. Wir haben dieses Verhalten aus unserer Sozialisation heraus so verinnerlicht, dass es von vielen Verlustängsten begleitet ist, zu einem “was bin ich eigentlich Selbst?”, oder „bin ich ausschließlich die Summe der ankonditionierten Bilder ?“, zu kommen.
Sie waren 1989 auf der allerersten Love-Parade in Berlin mit 150 Teilnehmern. Wie haben Sie die Zeit Anfang der Neunziger erlebt?
Es war wunderbar. Ich kam aus Nürnberg nach Berlin. Kaum war ich dort, habe ich Leute kennen gelernt, die genau dasselbe wollten wie ich: mit ein paar Synthesizern und Rhythmus-Maschinen eine neue Musik machen. Ich konnte an einer spannenden Entwicklung von etwas Neuem teilhaben und sie mitgestalten – etwas, das sich wohl jeder Künstler wünscht. Es gab damals keine Unterschiede zwischen Fans und Machern.
Wann hat sich das verändert?
Techno wuchs Anfang der 90er sehr schnell. Man kann sich das heute kaum mehr vorstellen: Eine Musikbewegung fand außerhalb der Leit-Medien und Major-Labels statt und wuchs überall auf der Welt – egal ob Detroit, Berlin oder London. Der Begriff „global village“ hatte damals für mich noch nicht den faden Beigeschmack von seiner heutigen Realität.
Sehen Sie sich heute noch als Teil einer „Techno-Szene“? Gibt es die überhaupt noch?
Allerspätestens 1999, als diese Musik zwei Jahre vor ihrem kommerziellen Höhepunkt stand, der gleichzeitig Gipfelpunkt einer künstlerisch beschämenden Armseligkeit war, habe ich aufgehört, mich mit Techno als perspektivische Popkultur auseinanderzusetzen.
Viele der Stücke auf „thinking about myself“ und „Stellar Supreme“ waren ihrer Zeit weit voraus. 1994 erschien die erste der „Cafe del Mar“-Compilations. Die Sampler lösten einen „Chill-out-Boom“ aus. Wie empfinden Sie Musik solcher Art?
Wer freut sich nicht darüber, Anteil an einer musikalischen Entwicklung zu haben. Doch schnell wurde aus der Freude darüber erst ein gewisses ungläubiges Staunen, dann nur noch Ärger: es hagelte Kopien von Kopien von Kopien, die in ihrer zunehmenden Belanglosigkeit nur noch verbrannte Erde hinterließen. Analytisch betrachtet ist das nichts Neues: In der Massenkonfektion wird irgendwann das gesamte Genre fragwürdig und ungenießbar, weil ihre Flut die wenigen guten Beispiele natürlich mit wegspült.
Am 11. Januar dieses Jahres ist Mark Spoon gestorben – mit unter an den Folgen exzessiven Drogenkonsums. Sie waren Anfang der Neunziger zusammen auf dem Label „Logic Records“. Wie gut kannten Sie ihn?
Dass wir Freunde waren, wäre zuviel gesagt. Aber wir hatten Begegnungen, an denen wir uns sehr nahe waren. Wir hatten ganz persönliche Abende zu zweit, ohne Publikum und ohne Beobachtung. Das waren sehr schöne Momente.
Welche Rolle haben Drogen damals gespielt?
Für Viele sicherlich eine sehr große. Je größer die Bewegung wurde, desto mehr Drogen kamen ins Spiel. Das waren Flucht – und Nachahmungseffekte: Es ist sehr verlockend, sich wegzuschießen, um sich bedingungslos mit „Haut und Haaren“ einer Sache ausliefern zu können. Ich für meinen Teil wollte genau das Gegenteil davon: durch bewusst Erlebtes die realen Zustände verändern. Letztendlich war das auf eine konträre Art genauso naiv.
Die Musik dem Album „Die Toteninsel“ und dem Nachfolgendem „Caged“ hat mit Techno nichts mehr zu tun. Was ist in der Zwischenzeit passiert?
Meine Verortung in der Gegenwart hat sich geändert. Die Situation, aus der heraus ich heute Musik mache, hat sich verschoben. Wollte ich in der „Cosmic Baby“-Welt noch einfache, sozusagen reine Zustände wie „traurig“, „verliebt“, „glücklich“ in musikalisch gefälliger Form abbilden, so interessieren mich seit Jahren komplexere, widersprüchliche innere Abläufe, die ich in musikalisch ausdrücken möchte. Das bedeutete: Suche nach neuen Darstellungsformen, Klängen und Kompositionstechniken. Was wiederum bedeutet: studieren, handwerklich dazu lernen, experimentieren und bewährte Wege verlassen können. Das braucht Zeit und Geduld. Rückbesinnungen auf Felder der klassischen Moderne wie „Musique Concrete“ inspirierten mich dabei mehr als der Begriff „Popmusik“. Ich würde meine eigene Musik heute eher als „Hörstücke“ bezeichnen.
In der „Toteninsel“ verbinden Sie Elemente klassischer Musik mit elektronischen Klängen, „caged“ ist ausschließlich für klassische Instrumente geschrieben . Wo sehen Sie die Chancen und wo die Grenzen elektronischer Musik?
Das verlockende und faszinierende an elektronischer Musik ist die Möglichkeit, mit relativ geringem Aufwand und ohne handwerkliche Fähigkeiten komplexe Ideen akustisch umsetzen zu können. Leider folgt daraus nicht zwangsläufig eine größere musikalische Vielfalt. Genau das Gegenteil ist zu hören: Die Musik klingt tendenziell immer gleicher, immer uniformer, un-unterscheidbarer, beliebiger – was wiederum kein musikspezifisches Problem ist , sondern einen allgemeinen Zustand (man denke nur an TV-Serien, Innenstadtstrukturen, Politikerstatements usw.) betrifft …
Woran liegt das?
Es geht nicht mehr um die Hingabe und das Erlebnis, etwas für sich und „an sich“ zu schaffen, sondern darum, möglichst schnell ein erfolgreich vermarktbares Produkt bereit zu stellen. Ganz allgemein: wir sprechen längst nicht mehr vom Kunstwerk, das sich nach dem eigenen Gehalt und seiner stimmigen Gestaltung richtet, sondern von industriellen Kunstprodukten, die sich ausschließlich am Profitmotiv messen lassen.
Im Booklet von „Cage“ beklagen Sie die totale Vereinahmung des Menschen durch Ökonomie. In „Die Toteninsel“ geht es Ihnen um den Widerspruch zwischen dem, was wir „denken zu sein“ und was wir wirklich sind. Kann Musik überhaupt solche komplexen Probleme aufgreifen?
Ich kann nicht so tun, als gäbe es da eine Grenze zwischen einer quasi idealen Kunstsphäre und den gesellschaftlichen Problemen, vor denen ich als realer Mensch nun mal nicht die Augen verschließen kann. Ich suche in der Analyse von Systemen nach eigenen Standpunkten. Kein System funktioniert so, wie es sich selbst darstellt. Auch dieses nicht, das, je stärker die gesellschaftlichen Widersprüche zunehmen, uns immer hysterischer einzureden versucht, so liberal, frei und unideologisch wie nur irgendwas zu sein – und gleichzeitig ständig den Druck auf die wachsende Anzahl ihrer Bürger erhöht, die an ihrem drohenden Fall in das existentielle Nichts selbst Schuld sein sollen.
Für mich ist eine Herausforderung zu versuchen, die Dinge, die mich am meisten in meinem Leben beschäftigen, in Musik umzusetzen. Gehe ich diesen Weg, muss ich mir darüber im Klaren sein, dass ich mich abseits der gängigen, vermarktbaren kommerziellen Strukturen bewege.
Das klingt alles sehr schön idealistisch. Aber meistens geht es doch nicht um ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl als auch. Sie waren berühmt, hatten einen guten Namen – warum wollen Sie darauf nicht aufbauen? Sie hätten es heute um einiges leichter…
Aber genau diese Suggestion des „Sowohl als auch“, dieses „die goldene Mitte finden“, ist doch die Wurzel dieser konturlosen, glattgebügelten, quotenkonformen, als sexy, schick und erfolgreich hin-designeten Scheinindividualität, die uns als Lebensfreude, Orientierungs- und Wertmassstab verkauft wird. Dieser Beckmann-Merkel-Bohlen-Fliege-Pluralismus macht mich krank.
Der Schriftsteller Helmut Krausser brachte es einmal sehr schön auf den Punkt: man muß kapieren, daß das alles nur Masken ein und derselben Figur sind. Die Verblödungsgesell-schaft bedient man, sobald man sich mit ihr einlässt. Egal wie.
Sie machen Ihre Pressearbeit selbst, kümmern sich um den Vertrieb und die Pressung. Ist das nicht wahnsinnig viel Arbeit?
Ja, das ist es. Andererseits konnte ich für mich den Beweis antreten, daß es möglich ist, Musik zu meinen künstlerischen Bedingungen zu gestalten: Ohne Businesspläne, Marketingargumente, Promokampagnen und das ständige Schielen auf irgendwelche Trend-Charts, Polls, Votings und Medienbarometer. Ohne Sponsering mit freundlicher Unterstützung der Firma X oder Y, ohne diese wichtigtuerischen und gleichzeitig entwürdigenden Blablablas mit Personen, die irgendwie „wichtig“ für „das Produkt“ zu sein scheinen. In meinen Augen wiegt ein wachsendes Stück qualitativer Unabhängigkeit den Verlust von quantitativem Aktionsradius, der allgemein als „Erfolg“ und „Popularität“ verstanden wird, auf.
Sueddeutsche Zeitung, 29.09. 2006, Interview von Philipp Mattheis
http://www.sueddeutsche.de/kultur/interview-mit-cosmic-baby-in-der-massenkonfektion-wird-das-genre-fragwuerdig-1.432999