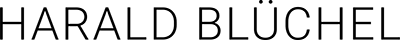I – DAS PROBLEM DER BEGRIFFLICHKEIT
Ein Phänomen, das inhaltlich eine Form annimmt und sich danach sowohl medial, als auch von der Öffentlichkeitsresonanz her ausbreitet, also zu einem verwertbaren Thema heranwächst, braucht irgendwann eine Begrifflichkeit, auf die sich alle einigen können. Expressionismus, Existenzialismus, Eklektizismus – wir wissen worüber wir reden.
Auch in der Musik lagen die Dinge relativ klar vor Augen: Ähnlich einem Periodensystem unterschied man ganz oben zwischen „E“ und „U“, definierte in einer zweiten, darunterliegenden Ebene deren Hauptgattungen nach Epochen und Stilen, um im letzten Schritt dann deren einzelne Untergattungen durchzudeklinieren. In der Klassischen Musik sprechen wir in der zweiten Ebene von Alter Musik, Renaissance, Barock, Klassik, Romantik, Spätromantik, Impressionismus, Moderne, Neuer (oder Zeitgenössischer) Musik. So weit, so gut.
II – DAS ENDE EINES DOGMAS
Die Schwierigkeiten begannen Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts und spitzen sich in der Gegenwart zu. Was geschah, war die Auflösung (aber nicht die Aufhebung!) von Gewissheiten und feststehenden Kategorien auf politischer, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und künstlerischer Ebene, die sich allesamt aus dem westlichen Dogma des unbegrenzten Fortschritts- und Superioritätsglaubens ableiteten. Was übrig blieb, ergab eine neue Gewissheit: Die Zeiten eines linear steigenden und qualitativen Wachstums sind vorbei. Wir stoßen an Grenzen. Das erstarrte Dogma vom unbegrenzten Fortschritt kann nur noch quantitativ am Leben erhalten werden.
III – KLASSISCHE KOMPOSITION UND TECHNO – EIN WIDERSPRUCH?
Die klassische Musik hat ein Problem. Sie ist musikalisches Chiffre und Gütesiegel für Hochkultur. Seine „Avantgarden des 20. Jahrhunderts begriffen sich selbst als einem ununterbrochenen Fortschritt verpflichtet und feierten den Schock, das Einzigartige und das gänzlich Neue.“ (Tilman Baumgärtel, „Schleifen“, 2015). Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Klassische Musik von etwa 1960 bis heute „Neue Musik“ oder „Zeitgenössische Musik“ heißt.
Beim Studium der Komposition an der HdK Berlin wurde ich dazu angehalten, im Sinne der Neuen Musik zu arbeiten. Stockhausen, Nono, Lachenmann! (Alle drei mag ich, weil das, was sie machten, hochinteressant, inspirierend und von einer absolut eindeutigen persönlichen Handschrift ist.) Ich nahm mir denselben Anspruch heraus. Wollte forschen an meiner eigenen neuen Neuen Musik. Ich hatte das Gefühl, dass es in der klassischen Neuen Musik aber nicht mehr weiter ging: NEUER ALS NEU war einfach nicht mehr zu machen. ZEITGENÖSSISCH zu komponieren schien mir dennoch möglich: aus dem historischen Fundus schöpfen und ihn mit gegenwärtigen Stilen und Produktionstechniken aus den fortschrittlichsten Pop-Kulturen räsonieren zu lassen.
Hingegen „Alte“ Musik im Gewand der Neuen Musik zu machen war mir einerseits zu formell (gute Exposés; kluge Bezüge zu erlaubten Kompositionsvorbildern herstellen; Musik machen, die neu klingt, aber nicht ist, sondern maximal ein Klangexperiment wie tausend andere) und andererseits zu verordnet in „erlaubt“ und „nicht erlaubt“.
Ich hatte etwas anderes im Kopf. Repetitiv und melodisch, vorwiegend elektronisch sollte es sein. Nicht unanspruchsvoll, aber einfach und übersichtlich in der Form. Meine klassischen Vorbilder Glass und Reich wurden an der Hochschule als „Pop-Musiker“ abqualifiziert und nicht ernst genommen (woraus leicht nachvollziehbar hervorgeht, dass die Nennung meiner weiteren Helden wie Kraftwerk oder Giorgio Moroder in den Augen meiner Herrn und Meister sowieso einem unglaublichen Irrsinn gleichkam …). Zudem missfiel mir das Konformitätsprinzip als einzig gehbarer Weg, als klassischer Komponist Karriere machen zu können:
- a) Mache „gefällige Musik“ innerhalb der Neue-Musik-Koordinaten (also: je formal „ungefälliger“, desto besser).
b) Füge dich möglichst eifrig in die Entourage deines Professors ein, um durch seinen Einfluss gefördert zu werden.
c) Bekomme auf diesem Weg Zugang zum geheiligten Subventionssystem aus Wettbewerben, Preisen, Stipendien und Auftragswerken.
Nichts hätte ich mir mehr gewünscht, als eine alternative Klassik-Szene. Doch etwas Vergleichbares war nur in den eher popmusikalischen Subkulturen zu finden. So fand ich meine Heimat Ende der 80er Jahre in der absoluten Geburtszelle der Berliner Technomusik: ein klassisch geprägter und ausgebildeter junger Komponist mit Analog-Synthesizern, Rhythmusmaschinen und Sequenzern … Der Rest ist Geschichte.
IV – DAS GENRE “NEOKLASSIK”
Wenn man für die musikalische Landschaft, die ich nun bald öffentlich vorstellen werde, die passende Landkarte, also den allgemein gängigen und akzeptierten Genrebegriff finden müsste, um mein Musikmaterial in eine Schublade einordnen zu können, dann wäre es wohl: Neoklassik.
In der PR-Maschinerie wird Neoklassik etwa so beschrieben: „Musiker und Komponisten, die derzeit erfolgreich mit dem Mix von Ernster Musik und Unterhaltungsmusik experimentieren – oft am Piano und häufig mit einem beachtlichen Aufgebot an Technik. Nicht alle haben eine klassische Ausbildung. Aber sie alle kombinieren klassische Kompositionsmuster mit modernen Denk- und Produktionsweisen und treffen damit den Nerv der Zeit“. Yeah! Und weiter: „Unaufgeregt, auch unproblematisch hört sich diese Musik an. (…) Der Puls der Neo-Klassik schlägt für den Wohlklang sowie Eingängigkeit – und das auch mit hohem, für die Clubbing-Welt typischem Bassanteil“. (Bettina Jech, Copyright: Goethe-Institut e. V., Internet-Redaktion, Juni 2016)
Ein Text von Tobias Ruderer („Die neueste Form der Gebrauchsmusik nennt sich Neoklassik. Spur einer Regression“ in VAN vom 29.7.2015) hört da schon genauer hin: „Zwischen Chopin-Projekten, Minimal-Epigonen und Sounddesignern hat sich ein neues Genre aufgetan. In der Basisform braucht es dafür nur ein paar arpeggierte Klavierharmonien und einen netten jungen Mann“. Hui, da fühle ich mich dann schon eher getroffen, hier dann eher wieder nicht: „Gegen all dies, Experiment, Design, einem ‚lasziven’ Umgang mit neuer Musik, mit dem klassischen Material, ist nichts einzuwenden, aber wer spricht von den Runde um Runde heruntergedudelten, immergleichen Harmonien, von a-Moll, F-Dur, a-Moll, F-Dur usw.? Sie bilden das stahlharte und unhinterfragte Gerüst, auf dem die kunsthandwerkliche Soundfeilerei (…) stattfinden kann: Da darf es ein bisschen rau, hier ein bisschen rauschig sein.“
Volker Schmidt geht in seinem Text „Crossover-Musik“ in ZEIT online dagegen pointiert eher mit der eigenen Zunft um: „Das begeistert Feuilletonisten: Dass harte Jungs und coole Indietypen sich mit Musik befassen, die von fern an Bach und Mozart, an Erik Satie oder wenigstens Steve Reich erinnert.“ Und begründet danach über eine Zustandsbeschreibung der bestehenden klassischen Szene seine Sympathie, mit dem er Musiker aus dem Neoklassik-Genre begleitet: „Im Elfenbeinturm der Klassik beteuern sie zwar gern, neue Hörer für ihre Musik gewinnen zu wollen. Doch viele Turmbewohner spachteln eifrig alle Risse zu, durch die eindringen könnte, was sie am meisten fürchten: das (vermeintlich) Triviale. Dabei ist nur wenig trivialer als rückwärtsgewandter Purismus. (…) Die meisten der Musiker, die sich jetzt das Etikett Neo-Klassik aufpappen lassen müssen, tun zum Glück einfach das, was gute Musiker schon immer taten: die Ohren offen halten, Einflüsse aus allen Ecken aufnehmen. Die Begeisterung über die Klassizismen aus der Independent-Ecke könnte bedeuten, dass sich das herumspricht. Dass endlich auch die Genres des Klassik-Reservats zu gewöhnlichem musikalischen Material werden, mit dem Kreative spielen dürfen, ohne beschimpft zu werden. (…) Nicht alles ist originell, was dabei herauskommt. (…) Doch es gibt großartige Resultate in ganz unterschiedlichen Ecken.“
V – PERSÖNLICHE EINSCHÄTZUNG
Ist Harald Blüchel nun „Neoklassik“ oder nicht? „Neo-Classical, Post-Rock, Modern Classical, Indie Classical. Künstler/innen müssen sich nicht in Begriffe einordnen. Aber verhindern, dass unter den Zuhörer/innen Landschaften entstehen, über die diese sich mit Landkarten verständigen, können sie auch nicht.“ (Tobias Ruderer ebd.)
So ist es. Zumal ich es eh nicht ändern kann. Was würde es nützen, meine Energie darauf zu verwenden, in einem Abgrenzungswettbewerb nur ja Argumente dafür zu liefern, nicht unter diesem Begriff eingeordnet zu werden? Und dass in dieses Spektrum im Laufe der Zeit auch immer mehr mediokre, marktgerechte Konfektionsware hineingeschoben werden wird, ist der Lauf der Dinge, sozusagen.
Auf jeden Fall aber gibt es unter den Künstlern, die nun zu den „Neoklassikern“ gezählt werden genügend, deren Musik ich außerordentlich schätze. Es gibt verwandte Ansatzpunkte in Sichtweise, Geisteshaltung, Ausdruck und Form, wie wir das Leben in dieser gegenwärtigen Welt musikalisch reflektieren und interpretieren können – zeitgenössische Musik, die sich aus dem unendlich großen Kosmos der klassischen Musik heraus identifiziert und ihn in die Jetztzeit weitertragen möchte.
Die Motivik, die hinter meiner Musik steckt, versuche ich in meinen Texten, die ich gerade schreibe, nachvollziehbar zu machen. Darüber hinaus kann ich mir nur wünschen, dass man meiner Musik begegnen kann. Am direktesten, wenn ich sie live spiele. Das ist das nächste, was kommen wird. Darauf bereite ich mich jetzt vor.